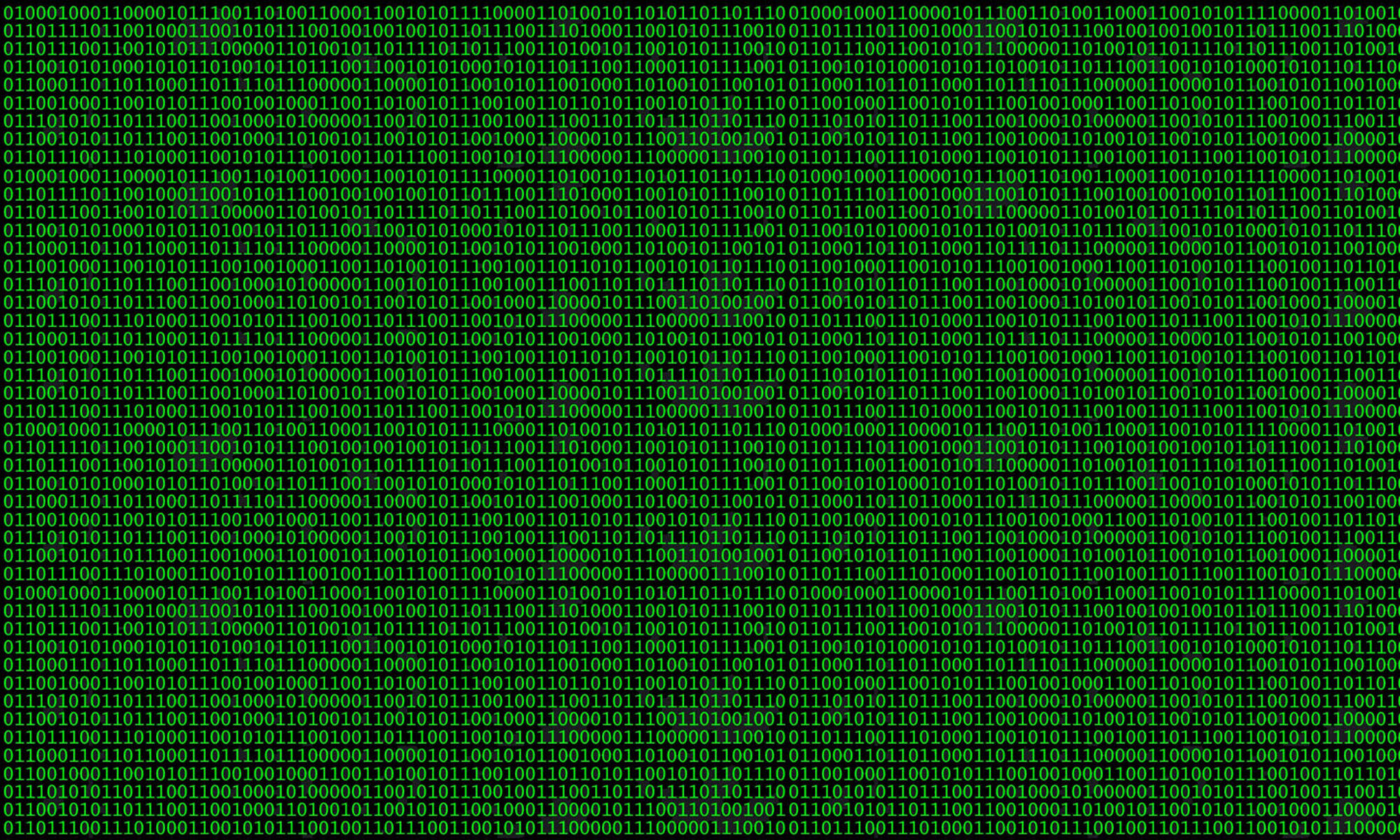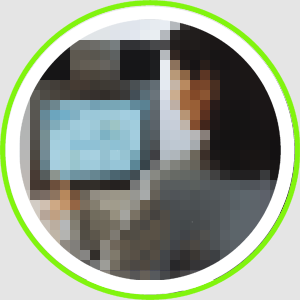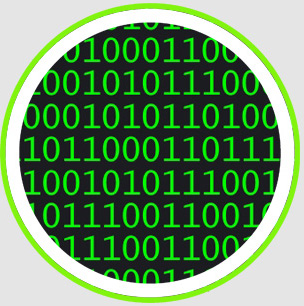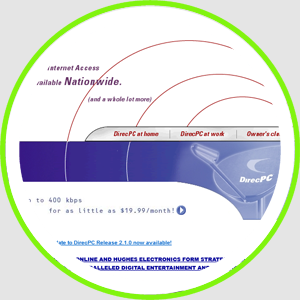Amerikanischer Elektroingenieur, Mitbegründer der Firma SUN.

„Eine Bombe kann man nur einmal zünden, ein Virus, eine Nanomaschine oder ein Roboter können sich zukünftig immer wieder neu erschaffen“, so warnte Bill Joy im Jahr 2000 vor den möglichen Auswirkungen zukünftiger Technologien. In einem Artikel, der im amerikanischen Magazin Wired unter dem Titel „Warum die Zukunft uns nicht braucht“ erschien, malte er ein düsteres Bild der Gentechnik, Nanotechnologie und Robotik und forderte die Selbstbeschränkung der Wissenschaft. Es sei „keine gute Idee, jedem den Zugang zu den Bauplänen der Atombombe zu geben.“ Seine Thesen sorgten, insbesondere im Feuilleton, wo sie wohlwollend aufgenommen wurden, für viel Aufsehen. Kritiker werfen ihm jedoch eine zu simple Weltsicht vor, die vom Science Fiction beeinflußt die Zukunft lediglich als Fortschreibung der Gegenwart beschreibt. Allerdings hat Joy die heutige Zeit maßgeblich mitgestaltet. Der 1954 in Detroit geborene Elektroingenieur war als Student in Berkeley der Chefentwickler des Betriebssystems „Berkeley UNIX“ (BSD), das zum Standard-Betriebssystem in Ausbildung und Forschung wurde. Da es außerdem die perfekte Unterstützung der Netzwerkprotokolle bot, wurde es zur Grundlage des Internet. Nach seinem Studium an den Universitäten von Michigan und Berkeley gehörte er 1982 zum Gründungsteam der Firma SUN. Dort wurde das von ihm entwickelte Betriebssystem als „SUN OS“ eingesetzt. Joy ist bei SUN als Chefwissenschaftler unter anderem maßgeblich an der Entwicklung der Architektur der Microprozessoren der Firma sowie an der Spezifikation der Programmiersprache Java beteiligt. Auch an „Jini“, einer Technologie, welche die Kommunikation zwischen diversen Elektrogeräten und deren Vernetzung ermöglicht, hat Joy, der inzwischen elf Patente hält, einen großen Anteil. 1997 wurde er zum Berater des amerikanischen Präsidenten Clinton, in Fragen der Datenkommunikation und der Informationstechnologien, ernannt. 1999 erhielt er den „Lifetime Achievement Award“ für die Entwicklung von Java.